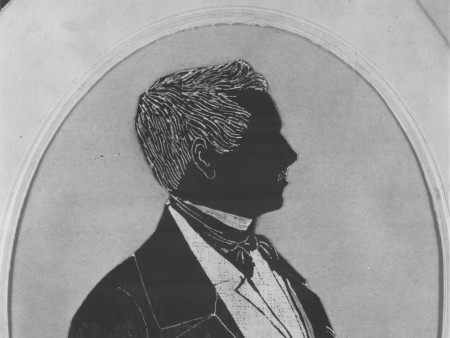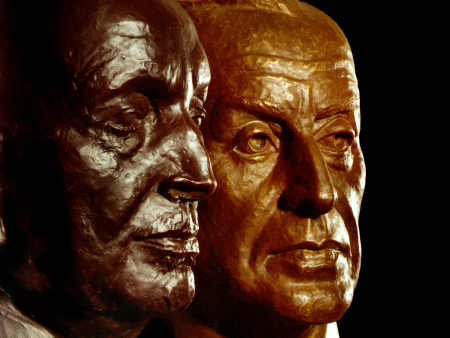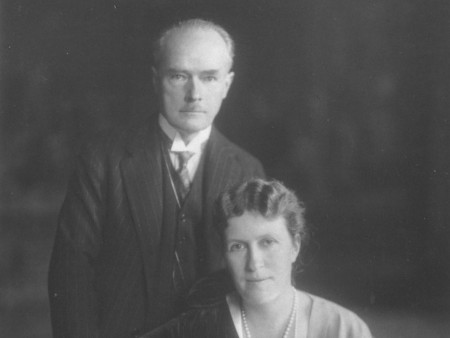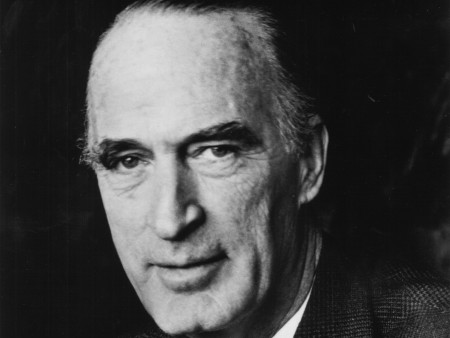Historie
Die Gründerfamilien
Ansprechpartner
Um Ihnen die schnelle und zielgerichtete Beantwortung Ihrer Fragen zu ermöglichen, erhalten Sie hier einige Hinweise, wer Ihr spezieller Ansprechpartner für Ihre Fragestellungen ist.
thyssenkrupp Corporate Archives
Andreas Zilt M. A.
thyssenkrupp Corporate Archives
47161 Duisburg
Historisches Archiv Krupp
Prof. Dr. Ralf Stremmel
Historisches Archiv Krupp
Villa Hügel, Hügel 1
45133 Essen
Villa Hügel, Hügel 1
45133 Essen
Telefon:+49 201 18848-21
/thyssenkrupp_logo_claim_d.svg)